|
Vor dem 30jährigen Krieg 110 Mühlen in der Prignitz
1618 sind in der Prignitz 89 aktive Mühlen im ländlichen Raum und 21 Mühlen in den 11
Städten bekannt. Damit versorgten 110 Mühlen 261 Dörfer und Städte der
Prignitz.
Die zunehmende Dichte der alten und neuen Mühlen führte in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts mehr und mehr zum Operieren mit Mahlzwang. Das heißt, Bewohner
bestimmter Orte, Ortsteile und Dörfer hatten bei der für sie vorgeschriebenen
Mühle malen zu lassen. Dazu gab es sogenannte Mahlgastlisten, die alle Personen
über 12 Jahre erfaßten. Aus der Personenzahl resultierte ein fester
Getreidebedarf, aus dem sich dann die Steuer für den Müller errechnete.
Der Mahlzwang war genau wie das Mühlenrecht, landesherrliches Recht. Schon
frühzeitig bemühten sich aber die Städte und auf dem Lande der Adel, dieses
Recht vom Landesherrn zu erkaufen oder zu pachten.
Zu den beiden Amtsmühlen bei Lenzen, der zweigängigen Wassermühle und der
1601 vor dem Seetor errichteten „Neuen Windmühle“ mit einem Gang, waren die Stadt Lenzen und die Dörfer Körbitz,
Baekern, Mödlich und Zuggelrade mahlpflichtig. Aus einem Schreiben des Jahre
1693 geht dagegen ausdrücklich hervor, daß in Lenzen die Wahl der Mühle den
Mahlgästen oblag; daß „den Einwohnern freie ‘Cvilkohr’ (Entscheidung) von
Alters zugestanden, in des Hauses Mühlen oder aber in des Herrn Hauptmanns
eigener Wassermühle zur Eldenburg, und andern an- und umliegenden, in- und
ausländischen Mühlen zu malen“.
| |
 Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker
Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker
Indes stritten sich mehr die Mühlenbesitzer wegen der Einnahmen, die ihnen verloren
gingen und wegen der zu entrichtenden Abgaben.
Zeitweiliger Mahlzwang wird aber existiert haben, denn es gibt Überlieferungen, nach denen
den Lenzener Bürgern das Getreide gepfändet wurde, daß sie heimlich zur Mühle
am Seetor gebracht hatten, weil ihnen der Weg zu des Amtes Wassermühle am See
zu weit war.
Die Lenzener aber rotteten sich zusammen, überfielen das Lager und „eroberten“ sich ihr
Getreide zurück.
|
| |
|
Nach dem großen Stadtbrand von 1703
1705 erhält der amtierende
Bürgermeister von Lenzen Johann Friedrich Katsch die Vollmacht für die
Verhandlungen zum Erwerb der Erbpacht über des Amtes Mahlmühle (Wassermühle)
und die beiden wüsten Windmühlenstätten.
Am 8. Januar 1706 wird der
Erbpacht-Kontrakt zwischen der Kammer und dem Herrn Hof- und Legationsrat v.
Quitzow über die Wassermühle zu Lenzen und die zu dem Zeitpunkt beiden wüsten
Windmühlenstätten „nebst dem von der letzt eingefallenen Windmühle annoch
vorhandenen Eisen und Steinwerck“ eingeschlossen. Demnach haben vor 1700 neben
der Wassermühle zwei Windmühlen existiert. Darüber hinaus gab es eine Roßmühle,
von der es im Jahre 1700 heißt, daß sie „vor undenklichen Zeiten“ eingerichtet wurde,
und daß diese allein in Notfällen, wenn die Elbe ausgelaufen (Hochwasser) und mit des Hauses (Amtes)
Mühle nicht gemalt werden kann, den Bürgern zugewiesen wurde, „die auch Ire
eigene Pferde darzu getan“. Ihr oblag es offensichtlich auch, die Malz-Metze
einzuziehen.
Weiter berichten die alten Akten: „Es ist bekannt, daß bei Bedarf seit „Menschen gedenken“ auch ein Müller
mit 6 Pferden von Seehausen zur Roßmühle kam und ungehindert den Einwohnern
auch das Malz darin gemahlen hat.
„Der Müller Pawel Blaffert ist auch nicht des Hauses (Amtes) Müller, sondern ein Bürger der Stadt gewesen und
hat den Bürgern mit ihren Pferden in derselben Stadt-Roßmühle Malz gemahlen und
nicht allein in Wassersnot, sondern sooft es ihnen gelegen und sich mit dem Rat
darum verglichen.
Kostenloses Bier für die Ratsherren
„Wie denn auch ein Müller
Peter Reinicke in der Stadt gewohnt und Burgmüller gewesen und den Bürgern
nicht allein in Wassersnot, sondern wenn Malz zu malen war die Roßmühle benutzt
und dafür dem Rat „zu vertrinken“ gegeben.
„Man will (um 1693) auch des
Hauses Windmühle nicht einfallen und vergehen lassen, so hätte man doch in
derselben und auch der Wassermühle an Rogken und Weitzen ohne das Malz der
Roßmühle genug zu malen“. Unsere Bäcker, so heißt es weiter, müssen sonst das
Weizenmehl von Seehausen und anderswoher holen.
Malz und Roggen können nicht gleichzeitig gemahlen werden
„Die Bürger, die Brauhäuser
haben, können auch mit Malz und Roggen zugleich nicht in des Amtes Mühlen
gefördert werden. Denn wenn Malz in die Mühle gebracht, muß eine Flasche oder
Kanne voll Bier dabei sein, darum der Roggen, ob der gleich zuvor dagewesen zu
der armen Leute großer Ungelegenheit hindan gesalzt.“ Oft haben die Leute
deshalb ihren Roggen wieder abgeholt und in die Eldenburger Mühle gebracht.
„Wie denn auch ein armer Mann seinen Roggen in der Amtsmühle gehabt, doch dort
weggekommen. Darüber von desselben Mannes Weib, nachdem sie mit ihren armen
Kindern kein Brot gehabt, zu großer Ungeduld bewogen, und ganz greulich
geflucht und gescholten hat.“
Der Rat hat auch, als die
Roß-Mühle baufällig geworden, zur Ausbesserung und Wiederaufrichtung derselben
Holz hauen lassen, daß aber bei der „erbermlichen Außbrennung“ der Stadt (1703)
mit verbrannte.“ Die Stadt hat aber an alter Stelle die verbrannte Mühle wieder
errichtet. Der ehemalige Standort ist nicht bekannt.
Zu den Problemen, die die
Lenzener Müller seit jeher hatten, gehörte einerseits das Hochwasser, wie denn
im 17. Jahrhundert berichtet wird, daß eine Windmühle vor dem hiesigen Seetor,
„welche, da sie in einer niedrigen Gegend gestanden, bei einem
Elbdeich-Durchbruch ruiniret“, also weggeschwommen sei. Außerdem führte der
Rückstau der Löcknitz bei Elbhochwasser zu dem Problem, daß auch die Flut, die
man damals Mühlenfließ nannte, rückwärts floß und deshalb in der Wassermühle
nicht gemahlen werden konnte.
Gildebrief des Müllergewerks Lenzen 1747
Frau Christa Kemski, geb. Gilberg, stellte uns freundlicherweise den Gildebrief des Müller-Gewerks Lenzen aus dem Jahre 1747 zur Verfügung, der interessante Details enthält.
| | |
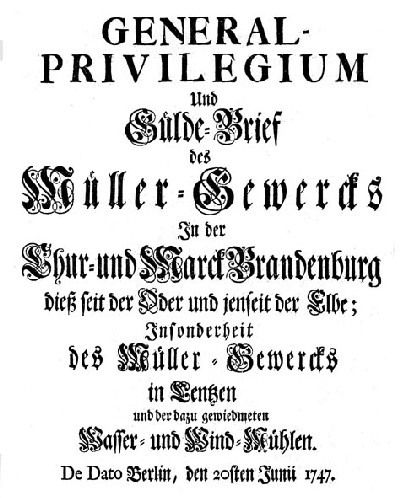 Gildebrief des Müller-Gewerks 1747
Gildebrief des Müller-Gewerks 1747
Zum Beispiel werden einige neue Privilegien bekannt gemacht, die "zur Verhütung aller Confusion und zur Vermeydung der vorhin so häuffig wegen nichtiger Ursachen angestrengten geldfressenden Processe" beitragen sollen.
Von Lehrlingen wurde verlangt, daß sie lesen und schreiben und wenigstens 5 Stücke aus dem Katechismus "hersagen" können. Die Probezeit eines Lehrlings war auf vier Wochen begrenzt.
Nach Abschluß der Lehre hatte der Geselle zu versprechen, sich "vor liederlicher Gesellschaft, Spielen, Sauffen, Huren, Stehlen und anderen Lastern zu hüten". Danach war er ohne andere "Ceremonien und Possen" loszusprechen.
Ferner wird berichtet, daß derjenige, der beim Gewerk der Müller Meister werden wolle, seinen Lehrbrief, "nebst denen seines guten Verhaltens wegen erhaltenen Kundschaften, Attestatis vorzeigen, auch das er wenigstens vier Jahre auf das Handwerk gewandert, erweisen muß."
|
Auf das Vorzeigen des Geburtsbriefes, der die eheliche Herkunft nachweist, wird verzichtet, weil dieser bereits zur Erlangung des Lehrbriefes vorausgesetzt wird. Im übrigen wurde auch die Soldatenzeit statt der Wanderjahre angerechnet.
Derjenige, dem es an Zeugnissen seines Wohlverhaltens fehlt, muß an dem Ort, wo er Meister werden will, ein halbes Jahr als Geselle arbeiten.
Das Meisterstück, sowohl für Wasser- als auch für Windmüller bestand aus einer Zeichnung sowohl einer Wasser- als auch einer Windmühle mit technischem Ablauf, die in eines Meisters Beisein anzufertigen war. Fehler am Meisterstück durften, wie früher üblich, nicht mehr freigekauft werden, ebenso wurden "die bey dieser Gelegenheit sonst gewöhnlichen Schmausereyen gäntzlich verboten". Wurden dem Meisteranwärter "ohne gegründete Ursache Schwürigkeiten gemacht" so konnte dieser auf eigene Kosten unparteiische Meister als Gutachter hinzuziehen.
Die Gesamtkosten der Meisterprüfung beliefen sich auf 12 Reichstaler, wovon 2 Reichtaler den gesamten Meistern "zur Ergötzlichkeit" zustanden.
Innungsversammlungen
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, lautet ein altes Müllerwort. Die Bevorzugung von Mahlgästen auch gegen Trinkgeld war bei Strafe verboten.
Aber wer sich von den Müllern bei Versammlungen um mehr als eine Stunde verspätete, hatte 2 Gute Groschen Strafe zu erlegen.
Das Statut von 1747 verbot die früheren "läppischen Ceremonien und Complimenten" wie auch den Alkoholkonsum während der Versammlungen. "Wenn sie zusammen trincken wollen" kann dies außerhalb der Gewerks-Angelegenheiten geschehen, heißt es.
Der Müller als Richter
Vom 30. Juni 1734 liegt folgendes Schreiben vor:
„Seiner königl. Majestät ist
bekannt geworden, daß Müller eine gewisse Jurisdiktion
(Rechtsprechung/Gerichtsbarkeit), der Trauer Mantel genannt, so eine Peitsche
ist, ausüben und sich anmaßen damit nach ihrem Gefallen die Mahlgäste zu
prügeln. Die Magistrate werden gebeten, Untersuchungen anzustellen und
fordersamst Bericht zu erstatten.“
Das Lenzener Müller-Privileg von 1747 verbietet außerdem aufs Schärfste, das Führen von sogenannten "Schwarzen Brettern" und alle "altväterische und theils abergläubische Ceremonien" mit der Innungslade. Sie ist wie jeder andere Kasten zu behandeln, außer, daß sie mit drei Schlössern versehen in des Altmeisters Hause aufzubewahren sei. Die drei Schlüssel hatten der Altmeister, der Beisitzer und der Jungmeister.
1810 Mangel an Windmühlen
Ob die zweite im Jahre 1706
genannte wüste Windmühlenstätte wieder aufgebaut wurde, entzieht sich unserer
Kenntnis. Fest steht dagegen, daß 1810 vom Mangel der erforderlichen Windmühlen
gesprochen wird, „und es kann die eine Bockwindmühle nicht das nötige Brotkorn,
geschweige das Brandtweinschrot und Malz abmahlen, so dass die Einwohner mit
vielen Kosten weit entfernt liegende Mühlen abfahren müssen, wodurch der
Betrieb ihres Gewerbes leidet und das Publicum gefährdet wird.“
Im gleichen Jahr, nämlich am
28.10.1810, wurde in Berlin das „Edikt wegen der Mühlengerechtigkeit und
Aufhebung des Mühlenzwanges und des Bier- und Brantweinzwanges in der ganzen
Monarchie“, §§ 6, 7, 8 veröffentlicht. Dies führte spontan zur Errichtung
vieler neuer Windmühlen im ganzen Land.
| | |
 Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840
Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840
So auch in Lenzen. Es
berichtet die Mühlen-Akte des Magistrats zu Lenzen (Brandenburg.
Landeshauptarchiv Potsdam, Rep.8/Lenzen 55 C) von einer vor dem Seetor
anzulegenden Windmühle im Februar 1811 und, daß sich der Mühlenmeister Johann
Ludwig Rothfahn aus Gartow bewirbt, eine Windmühle auf seine Kosten mit 2 oder
3 Gängen zu bauen; „links vom Damm nach dem Sandfurt zu“ 30 x 30 Schritte.
Desgleichen bewirbt sich der Brauer und Bürger Wilhelm Rohde, der rechts vom
Damm eine Mühle errichten will.
|
| |
|
Ersteigert und bald wieder Pleite
Es wird bis 30 Reichstaler
gesteigert, bis Rothfahn erklärt, eine Holländerwindmühle mit Spitzgang zu
bauen. Darauf erklärte Rohde, ebenfalls statt einer Bockmühle eine holländische
Mühle bauen zu wollen und ebenfalls 30 Reichstaler geben wolle.
Darauf erklärte Kahnführer Ohnesorge er wolle auch eine holländische Mühle bauen und 31 Reichstaler Pacht
geben. - Sie steigern dann bis 40 Reichstaler.
Der in Lenzen bemittelte
Brauer und Grundbürger Rohde erhält für 41 Reichstaler schließlich den Zuschlag
unter den Bewerbern, da er „der annehmlichste“ ist. Er hat die Mühlenprofession
erlernt und auf mehreren Mühlen als Bescheider (Geselle) gearbeitet. „Die
Stelle, wo diese Mühle erbaut werden kann, ist vor dem entgegengesetzten Thor
als wo die jetzt in Erbpacht stehende Mühle des Müllers Wieggreffe sich
befindet und gewiß 400 Ruthen entfernt.“ Mit dem entgegengesetzten Tor ist das
frühere Berg- oder Berliner Tor gemeint. Die Windmühle stand dort, wo die
ehemals Gilbergsche Villa steht. Der damalige Besitzer war vermutlich sowohl
Wasser- als auch Windmüller, sodaß Windstille und Hochwasser seinen Betrieb nur
bedingt einschränken konnten.
Am 16.11.1811 bittet Rohde
jedoch abweichend von seinem Angebot „wegen der hohen Kosten“ statt der
holländischen Mühle doch eine Bockwindmühle mit 2 Gängen (Rheinschen Gang und
Sandgang (Rheinschen Stein und Sandstein)) bauen zu dürfen.
„Da nun bey der Bockwindmühle
(wegen der fast bis auf den Erdboden reichenden Flügel) sehr leicht das
Weide-Vieh zu Schaden kommen kann“ erhält Rohde am 17. November 1811 die
Auflage, daß er ein „tüchtiges Gehäge“ (Umzäunung) anfertigen und erhalten
soll.
Am 21. September 1811
widerruft aber die Stadt ihre Zusage. Am 6. Oktober gleichen Jahres genehmigt
die Stadt jedoch wieder, aber unter der oben genannten Auflage und dem Hinweis,
daß Rohde zu Schaden gekommenes Vieh doppelt zu bezahlen habe.
Der Holzkauf, Eiche und Rüster
und eine Eiche aus dem Unterholz, erfolgt am 30. Januar 1812. Die
Baugenehmigung vom 11. März 1812 wird bereits am 16. März 1812 widerrufen. Die
Gründe für die dauernden Querelen entziehen sich unserer Kenntnis. Schließlich
wird Rohde am 7. September 1812 der Bauplatz von 30 Schritten im Durchmesser
angewiesen.
„An Ort und Stelle fand sich
nun, daß der Mühlen-Schwanz vom Mehlbaum allein 19 Schritt von demselben
entfernt ist“ und man unmöglich näher als 22 Schritt um denselben fahren könne.
Es heißt, daß 45 Schritt um die Mühle inkl. Mehlbaum im Durchmesser, der ganze
Durchmesser 135 Werkfuß (?) plus 15 Schritte für Gehege benötigt würden; dazu
ein Stall von 18 Fuß lang und 12 Fuß breit. (später 30 x 12 Fuß)
Müller Rohde scheint mit dem
Bau nicht glücklich geworden zu sein. Im Jahre 1816 beantragt der Magistrat
Lenzen die Pfändung von Stammholz beim Leuengarten, das Müller Rohde dort
aufgehäuft hat; Wert ca. 300 Taler. Er hat bei der Stadt Holzschulden von 352
Taler und Rückstand der Mühlenpacht von 164 Talern, demnach hat er seit dem Bau
der Mühle noch nie bezahlt.
1818 beantragt Rohde den Bau
einer Roßmühle (wohl Lütkes Grundstück, die spätere Hundeküche der NVA) weil er
in den niedrigen Wiesen oft keinen Wind habe. Die Akte endet ohne Antwort auf
dieses Begehren. Wilhelm Rohde stirbt jedenfalls nicht als Müller, sondern als
Brauer und Branntweinbrenner in Lenzen.
Die Lenzener Mühlen und Müller im 19. Jh.
Die Zahl der Müller und Mühlen
nimmt um die Mitte des 19. Jahrhunderts sowohl in Lenzen als auch in den
umliegenden Dörfern deutlich zu. Im Lenzener Kirchenbuch und in den teilweise
erhaltenen Mühlenakten tauchen folgende Müllerfamilien auf, die den folgenden
Mühlen zugeordnet werden konnten:
1. Windmühle, Holländermühle, Finkenberg links
Fehrmann, Friedrich Wilhelm,
Müller von 1821-1862, danach war er als Mühlenbaumeister tätig. Es folgen seine
Söhne Wilhelm, geb. 1824 und Carl, geb. 1831. In 3. Generation übernimmt den
Betrieb 1892 der 1862 geborene Enkel Ernst Fehrmann, der 1895 als Mühlenmeister
und Bäcker und 1897 nur noch als Bäckermeister tätig ist, weil das billige
Industriemehl den Windmühlenbetrieb überflüssig gemacht hatte.
2. Windmühle, Holländermühle, Finkenberg Mitte
Mühlenbesitzer waren Johann
Schulz 1864-1878 (ursprünglich Holzhändler in Lenzen), dann der aus Gandow
stammende August Busse 1879- mindestens 1885, gefolgt 1890 von August Schalkow.
Da Schulz und Busse nur als
Mühlenbesitzer bezeichnet werden ist davon auszugehen, daß die Mühle
größtenteils verpachtet war.
3. Windmühle, Bockwindmühle, Hechtsfurtmühle, rechts hinter dem ehem. Judenfriedhof
Der 1809 in Lenzen geborenen
Friedrich Jäger ist zunächst Seilermeister in Lenzen, dann aber von 1862 bis
1872 als Mühlenmeister in Lenzen tätig. Zwei Jahre vor seinem Tod übergibt er
1872 die Mühle seinem Sohn, dem Mühlenmeister August Jäger, der sie bis etwa
1883 betreibt. 1885 ist er nur noch als Ackerbürger in Lenzen tätig und um 1890
verkauft er die Bockwindmühle an Günter August Borchard, der sie noch 1914
besitzt.
4. Windmühle, Bockwindmühle, vor dem Seetor
|
| |
 Mühle vor dem Seetor 1903
Mühle vor dem Seetor 1903
Der Standort vor dem Seetor
gehört sicher zu den ältesten Windmühlenstandorten in Lenzen. Die nach 1499
gebaute Windmühle des Amtes wird in diesem Bereich gestanden haben. Das älteste
Gemälde der Stadt von dem holländischen Maler Pijnaker aus dem Jahre 1654
existiert im Original nicht mehr. Ein vermutlich danach gefertigtes Ölgemälde
befindet sich in der stadtgeschichtlichen Ausstellung auf der Burg Lenzen.
Dieses diente offensichtlich als Vorlage für einen Stich, der in der Lenzener
Chronik des Dr. Ferdinand Ulrici von 1848 abgedruckt wurde.
Bekannte Besitzer der Mühle
vor dem Seetor waren Wilhelm Rohde ab 1812 und später Christian Lent, der das
Mühlengrundstück 1880 von der Stadt erwarb. Spätestens 1908 übernahm sein
ältester Sohn Ernst Lent als Mühlenmeister die Mühle. Doch auch dieser Betrieb
litt zusehens unter billigem Industriemehl aus Amerika und der Mühle
„Findenwirunshier“ (Neu Kaliß/Heiddorf). Ernst Lent wurde Landwirt und stellte
in den 20er Jahren den Mühlenbetrieb ein. Die Mühle verfiel und wurde
schließlich 1935/36 abgetragen und das Grundstück für 750,- Reichsmark wieder
an die Stadt verkauft.
5. Windmühle, Holländermühle, auf dem Grundstück der ehemals Gilbergschen Villa.
6. Wassermühle, an der Flut bzw. Mühlenfließ
Die 1601 erwähnte Wassermühle
wird höchstwahrscheinlich schon damals am Auslauf des Rudower Sees gestanden
haben, möglicherweise bereits auch früher. Akten aus dem Jahre 1648 wegen
Erweiterung des Mühlengartens belegen jedenfalls diesen Standort.
Nachdem sie im 19. Jahrhundert angeblich abbrannte, wurde sie als Massivbau neu errichtet.
Wenigstens zeitweilig ist
nachgewiesen, daß Wind- und Wassermühle 5. und 6. durch denselben Besitzer
betrieben wurden. So konnte bei Windstille die Wassermühle genutzt werden und
bei Hochwasser und Rückstau der Flut die Windmühle, sofern der Wind ausreichte.
Schließlich haben wir in der Prignitz im Jahresdurchschnitt nur 183 Tage
ausreichend Wind, um eine Mühle zu betreiben. Vier Windstärken sind nötig um zu produzieren, das heißt wenigstens schroten zu können. Erst bei Windstärke sechs und sieben kann optimal Getreide gemahlen werden. Windstille war ein häufiges
Problem der Müller und so stapelte sich angeliefertes Getreide oft lange Zeit
in den engen Windmühlen. Folgende Besitzer der Mühlen 5 und 6 sind bekannt:
1706 in Erbpacht der Herren v.
Quitzow, mindestens 1722 bis 1727 Peter Müller, 1766 wird Johann Mackel als
Erbmühlenmeister von Lenzen und Eldenburg genannt. Durch die Verlegung des
Amtssitzes von der Burg Lenzen nach
Eldenburg im Jahre 1767 ging nicht nur die Burg in Privatbesitz über, sondern
auch die Amtsmühlen gehörten von nun an zum Amt Eldenburg-Lenzen.
Mackels Schwiegersohn, der aus
Wittenförden stammende Sohn eines Oberförsters, Franz Joachim Rochow übernahm
die Mühle 1767 und behielt sie bis zu seinem Tode um 1780. Es folgte 1781 bis
1808 als Mühlenmeister der Wasser- und Windmühle Joachim Ernst Knaack, der die
Witwe des letzten Mühlenmeisters ehelichte, um in den Betrieb zu kommen. Er übergibt
die Mühle aber 1809 an den Müller Wiegreffe und verstirbt als Mühlenmeister in
seines Vaters ehemaliger Mühle in Triglitz. Es folgt ein Mühlenmeister
Bernhardt, der 1834 die Mühle an Rochows ältesten Sohn Friedrich Wilhelm,
geboren 1779, verkauft. Dieser war zuvor in Lindenberg als Mühlenmeister tätig.
Seine Söhne, Friedrich Rochow,
geb. 1809, und Ludwig Rochow, geb. 1814 wurden seine Nachfolger, bevor Wilhelm
Ludwig Thal von 1849 bis 1868 die Mühle übernahm. Als Mühlenmeister folgt
Hermann Rochow, Ludwigs ältester Sohn im Jahre 1871. Schließlich wird Arnold
Grundt von 1867 bis 1879 ebenfalls als Mühlenmeister genannt. Später wird
selbiger Kaufmann in Lenzen und ist nur noch Mühleneigentümer. Welche der
Meister sich auf die Wind- und welche sich auf die Wassermühle beziehen, bleibt
weiteren Recherchen vorbehalten. Schließlich kauft der aus Mecklenburg
gebürtige Wilhelm Gilberg 1891 die „Eldenburger Wassermühle“ am See. Sie wurde
zwischenzeitlich auf Dampfbetrieb umgestellt und später elektrifiziert.
|
Seine Söhne Wilhelm, geb. 1892
und Karl, geb. 1894 setzten den Mühlenbetrieb fort. Karl wurde im „3.Reich“
Bürgermeister von Lenzen und von der Bevölkerung nur „Karl-Ich“ genannt, weil
seine Sätze stets mit „Ich“ begannen. In 3. Generation war Wilhelms Sohn Horst
in der Mühle tätig.
Familie Gilberg wurde 1961 im Zuge der zweiten
Ausweisung aus Lenzen und dem Sperrgebiet ausgewiesen. Die Mühle wurde von der
LPG weiter betrieben.
| | |
|
Billiges Industriemehl führt zum Windmühlensterben
Auf der Katasterkarte vom
Jahre 1881 sind im Bereich Lenzen diese 5 genannten Windmühlen und die zuletzt
beschriebene Wassermühle verzeichnet, davon sind: 2 Holländerwindmühlen auf dem
Finkenberg und 1 Bockwindmühle auf dem Galgenberg (rechts hinter dem
Judenfriedhof). Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, daß sich die
Galgenberge (Mehrzahl!) von dort aus über das Alten- und Pflegeheim und das
Bahnhofsgelände bis zur Brauerei Schack erstreckten. Weiter gab es 1
Bockwindmühle vor dem Seetor, 1 Holländerwindmühle auf dem Hausgrundstück
Gilberg und 1 Wassermühle, die zu Eldenburg gehörte. Zwei der fünf Windmühlen
von Lenzen gingen noch vor 1900 ein, die anderen drei vor 1920. Ernst Lent mit
seiner Bockwindmühle vor dem Seetor war Lenzens letzter Windmüller.
Anschrift:
Förderverein Historische Bockwindmühle Lenzen e.V., Finkenbergstr. 6, 19309
Lenzen (Elbe),
Spendenkonto: Sparkasse Prignitz, BLZ 16050101, Konto: xxxxxxxxxx,
Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.
Georg Grüneberg
| |
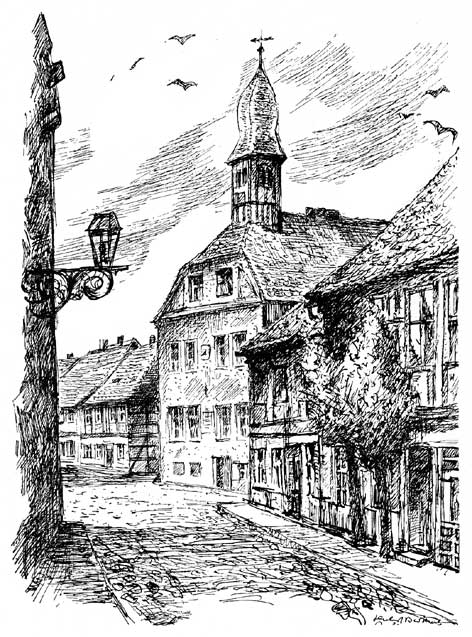 Rathaus - Stich von Herbert Bartholomäus
Rathaus - Stich von Herbert Bartholomäus
 Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker
Lenzen im Jahre 1654 - Stich nach einem Gemälde des niederländischen Malers Adam Pijnacker
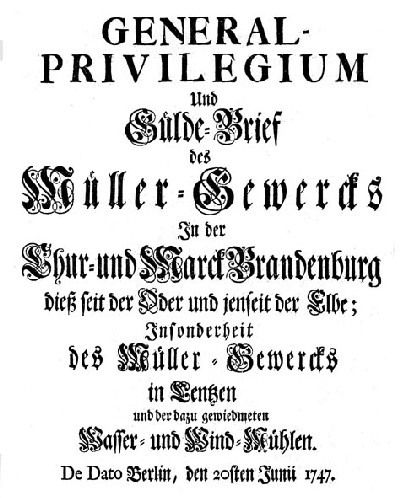 Gildebrief des Müller-Gewerks 1747
Gildebrief des Müller-Gewerks 1747
 Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840
Bockwindmühle vor dem Seetor um 1840
 Mühle vor dem Seetor 1903
Mühle vor dem Seetor 1903